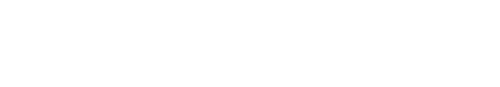9561490
EURO-FH ALPS 2 Glossar
Resource summary
| Question | Answer |
| Absichtsüberlegenheitseffekt | beschreibt das Phänomen, dass unerledigte Handlungen im Vergleich zu abgeschlossenen in einem Zustand erhöhter Aktivität im Gedächtnis verharren |
| Abwehrmechanismus | nach Freud ein Mechanismus des Ich, inakzeptable Triebwünsche des Es abzuwehren |
| Akquisitionsphase | Lernphase bei der klassischen Konditionierung, in der der CS zusammen mit dem US präsentiert wird; bei der operanten Konditionierung die Phase, in der dem Verhalten ein Verstärker |
| Amygdala | Kern im vorderen Temporallappen von der Größe und Form einer Mandel; nimmt wichtige Rolle bei der Furchtkonditionierung ein |
| Anspruchsniveau | im Bereich der Leistungsmotivation der Gütemaßstab, den eine Person für eine künftige Leistung in einer ihr bekannten Aufgabe explizit zu erreichen versucht |
| Appraisaltheorie | unter diesen Begriff werden Theorien der Emotionsgenese zusammengefasst, die die kognitive Einschätzung der Situation für das Zustandekommen einer Emotion als wesentlich ansehen |
| Arbeitsgedächtnis | von Baddeley und Hitch formulierte Konzeptualisierung des KZG, bei dem die Funktion eines solchen Kurzzeitspeichers im Vordergrund steht; Komponenten des AG sind die Phenologische Schleife, der räuml.-visuelle Notizblock, die Zentrale Exekutive und der episodische Puffer |
| attributionale Motivationstheorie | hat zum Gegenstand, wie sich die wahrgenommenen Ursachen von Handlungen auf Erwartung und Wert und damit auf die Auswahl und Ausführung von künftigen Handlungen auswirken |
| Attributionstheorie | nimmt an, dass eine bestimmte Art von Kognition, nämlich Zuschreibungen (Attributionen), wichtige Auswirkungen auf Emotion und Motivation haben; eine wichtige Form der Zuschreibung ist die Kausalattribution (Ursachenzuschreibung) |
| Bewusstseinslage | im Rubikon-Modell der Handlungsphasen versteh man unter der B. eine bestimmte kognitive Einstellung und Art der Informationsverarbeitung, die den jeweiligen Anforderungen der Handlungsphasen gerecht wird; realitätsorientierte B. ist gekennzeichnet durch objektive, offene, unparteiische Informationsaufnahme und -Verarbeitung; realisierungsorientierte B. ist gekennzeichnet durch subjektive, parteiische und eher fokussierte Verarbeitung |
| Blocking | im Bereich der klassischen Konditionierung der Effekt, dass ein CS, der bereits einen US zuverlässig ankündigt, die Assoziation eines zusätzlichen CS mit eben diesem US verhindert (blockiert); Effekt widerspricht Prinzip der Kontingenz |
| Circumplexmodell | Emotionsmodell von Russel, das die Emotionen in einem Koordinationssystem mit den beiden Dimensionen Valenz und Arousal aufspannt |
| Darbietungsregel (Display rules) | kulturspezifische regeln, die das Zeigen von Emotionen betreffen; soll erklären, dass das Zeigen von Emotionen kulturellen Regeln unterworfen ist, während emotionsspezifische Gesichtsausdrücke sich zwischen den Kulturen kaum unterscheiden |
| Effektantizipation | mentale Vorwegnahme eines Handlungseffekts |
| Emulationslernen | beim Emulationslernen wird durch Beobachtung etwas über die Funktion von Objekten in der Welt gelernt |
| episodisches Gedächtnis | im episodischen LZG werden autobiografische Erinnerungen im raum-zeitlichen Kontext gespeichert |
| evaluative Konditionierung | bei der e. K. wird ein affektiver Reiz mit einem neutralen Reiz gepaart; in der Folge kommt es zu einer Valenzverschiebung bei dem vormals neutralen Reiz, der die Valenz des affektiven Reizes annimmt; im Gegensatz zur k. K. ist die e. K. extrem löschungsresistent und nicht abhängig von Kontingenz |
| Extinktion | auch Löschung genannt; ist bei der k. K. die Phase nach der Akquisitionsphase, wenn der CS allein dargeboten wird; während der E. lässt die CR nach bis der CS keine CR mehr auslöst; bei der o. K. ist jeder Durchgang, in dem der Verstärker nicht gegeben wird, eine E. |
| Facial-Feedback-Hypothese | Annahme, dass die Wahrnehmung der Veränderung der eigenen Mimik die entsprechende Emotion auslösen kann |
| Feldtheorie | Motivationstheorie von Kurt Lewin; danach erzeugen Wünsche und Absichten einen Spannungszustand, der zum Handeln drängt; Gegenstände oder Ereignisse die geeignet sind den Spannungszustand zu beenden erhalten Aufforderungscharakter; diese wirken als Feldkräfte in dem Sinne, dass sie psychische Prozesse und die Motorik beeinflussen; die durch den Aufforderungscharakter veranlassten Handlungen führen zur Sättigung des Quasibedürfnisses und damit zum Ausgleich der Spannung |
| Gedächtnisspanne | Menge an Informationen, die im Kurzzeitgedächtnis kurzfristig aufrecht erhalten werden kann, beträgt 7 + / - 2 Chunks |
| Generalisierung | bei der k. K. wird die CR nicht nur durch den CS sondern auch auf Reize gezeigt, die dem CS ähnlich sind; die CR generalisiert |
| Gesetz des Effekts | von Thorndike formuliertes Lernprinzip, das besagt, dass aus einer Menge von Handlungen diejenigen mit höherer Wahrscheinlichkeit ausgeführt wird, die in der Vergangenheit zu positiven Konsequenzen geführt hat |
| Habit | Gewohnheit; Komponente in der Verhaltensgleichung der Triebreduktionstheorie von Hull; Stärke des Habit hängt von der Anzahl der verstärkten Lerndurchgänge in der Vergangenheit ab; Habit gibt dem Verhalten eine Richtung |
| Hippocampus | Gedächtnisstruktur im medialen Temporallappen; anteriorer Teil des Hippocampus scheint insbesondere für die Gedächtniskonsolidierung expliziter Gedächtnisinhalte von Bedeutung zu sein |
| Implementierungsintention | auch: Vorsatz; Wenn-Dann-Regel, wobei im Wenn-Teil möglichst spezifisch Zeit, Ort und Mittel zur Zielerreichung festgelegt werden sollten, und im Dann-Teil eine konkrete Handlung spezifiziert wird |
| klassische Konditionierung | von Ivan Pawlow entwickeltes Lernparadigma, bei dem ein zunächst neutraler Reiz mit einem unkonditionierten Reiz (US), der eine unkonditionierte Reaktion (UR) auslöst, gepaart wird; nach mehreren Paarungen wird der vormals neutrale Reiz zum konditionierten Reiz (CS) und löst allein die konditionierte Reaktion aus (CR) |
| kognitive Theorie des sozialen Lernens | von Bandura formuliertes Modell, dass verschiedene Einflussfaktoren des sozialen Lernens berücksichtigt; es unterscheidet die Prozesse Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Reproduktion und Motivation |
| Kompetenz | Lernen muss sich nicht unbedingt im Verhalten zeigen, sondern kann zunächst im nicht direkt beobachtbaren Kompetenzerwerb münden |
| Konsolidierung | Prozess der Verfestigung von Gedächtnisinhalten im LZG |
| Kontexteffekte | Ähnlichkeiten zwischen Enkodier- und Abrufkontext unterstützen die Gedächtnisleistung; Kontexteffekte wurden für räumliche, zeitliche, physiologische, kognitive und emotionale Merkmale gefunden |
| Korrespondenzproblem | damit wird die Schwierigkeit bezeichnet, mit der die sensorische Information der Beobachtung in ein motorisches Programm der Nachahmung übersetzt wird |
| latentes Lernen | Lernen kann auch ohne Verstärkung stattfinden, es kommt zum Kompetenzerwerb; damit das Verhalten dann auch gezeigt wird, bedarf es eines Anreizes |
| Mehrspeicher-Modell | auch: Drei-Speicher-Modell; von Atkinson und Shiffrin aufgestelltes Gedächtnismodell das drei Speicher, das sensorische Register, das KZG und LZG annimmt |
| Mikroexpression | schnelle und meist schwache Mimikveränderungen die nur schwer kontrollierbar sind und Aufschluss über den "wahren" emotionalen Zustand liefern |
| Mimikry | Nachahmung einer Verhaltensweise, ohne dass der nachahmende die Ziele des Modells verstehen muss |
| nicht-deklaratives Gedächtnis | Teil des LZG, dessen Inhalte sich in der Regel nicht verbalisierend lassen, sondern sich eher in der Performanz ausdrücken; hierzu gehören motorische Fertigkeiten und regelhafte Ereignisabfolgen |
| OCC Model | Modell der Klassifizierung von Emotionen; es werden objekt-, ereignis- und handlungsbezogene Emotionen unterschieden |
| Performanz | Zeigen des Gelernten im Verhalten |
| Prospect-Theorie | von Kahnemann und Tversky formulierte Erweiterung der SEU-Theorie, die unterschiedliche Nutzenfunktionen für Gewinne und Verluste annimmt, die berücksichtigt, dass Menschen kleine Wahrscheinlichkeiten häufig überschätzen |
| Risiko-Wahl-Modell | Modell der Leistungsmotivation von Atkinson, das Wahlen von Aufgabenschwierigkeiten in Leistungssituationen vorhersagen soll |
| Rubikon-Modell | Rubikon-Modell der Handlungsphasen beschreibt den Handlungsverlauf motivationaler und volitionaler Phasen von der Zielsetzung bis zur Zielrealisierung und Bewertung; dabei werden die unterschiedlichen kognitiven Anforderungen in den einzelnen Handlungsphasen berücksichtigt |
| Semantisches Gedächtnis | umfasst das im Laufe eines Lebens angeeignete Sach- und Bedeutungswissen eines Menschen und ist damit Teil des LZG |
| SEU-Theorie | Entscheidungstheorie, die vorhersagt, dass diejenigen alternativen gewählt werden, die den größten subjektiv erwarteten Nutzen erbringen |
| 7 Sünden des Gedächtnisses | von Daniel Schacter vorgeschlagene Nomenklatur zur Einordnung von Gedächtnisfehlern; 3 Sünden des Vergessens: Zerfall, Geistesabwesenheit, Blockierung 3 Sünden des falschen Erinnerns: Fehlattribution der Quelle, Beeinflussbarkeit, Verzerrung 7. Sünde: Persistenz von Gedächtnisinhalten, die unkontrollierbar ins Bewusstsein drängen |
| somantische Marker | gespeicherten körperlichen Empfindungen als effektive Folgen einer früheren Entscheidung; gemäß der Theorie der somantischen Marker werden diese Marker bei künftigen Entscheidungen reaktiviert und leiten die Handlungsauswahl |
| Spontanerholung | Wiederauftauchen der CR nach erfolgter Löschung bei der k. K.; S. spricht dagegen, dass während der Löschung die Assoziation zwischen CS und US vollständig rückgängig gemacht wird |
| Thematischer Apperzeptionstest (TAT) | projektiver Verfahren zur Messung von Leistungs-, Macht- und Anschlussmotiv; dabei werden mehrdeutige Bilder vorgegeben, zu denen die Versuchspersonen Geschichten erzählen sollen; wegen schlechter Gütekriterien umstritten |
| Verstärkungsplan | legt Regeln fest, nach denen eine Belohnung oder Bestrafung gegeben wird; kontinuierliche Pläne, bei denen jede gewünschte Reaktion verstärkt wird (-> schneller Verhaltensaufbau); intermittierende Pläne, bei denen nicht jede Reaktion verstärkt wird (-> löschungsresistenter) |
| Zwei-Wege-Theorie | Zwei-Wege-Theorie der Furcht von Joseph LeDoux; beschreibt zwei Wege der Furchtentstehung: kurzer Weg (low road): Informationsverarbeitung vom Thalamus direkt zur Amygdala; langer Weg (high road): kortikaler Weg über neokortikalen Assoziationsareale zur Amygdala |
| Patientin A. J. | Patientin mit autobiographischem Gedächtnis |
| Fall des kleinen Albert | Phobie vor weißen Ratten hervorgerufen durch k. K. und Vermeidungslernen |
| Fall des kleinen Peter | Beseitigung von Kleintierphobie durch Desensibilisierung und Modelllernen |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.