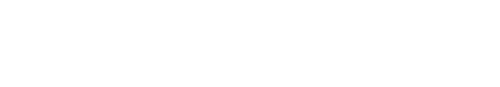16389674
GP
Description
No tags specified
Flashcards by Lolo Medina, updated more than 1 year ago
More
Less
|
|
Created by Lolo Medina
almost 6 years ago
|
|
Resource summary
| Question | Answer |
| Gegenstand der Klinischen Psychologie | • Psychische Störungen, psychische Krisen, psychische Aspekte körperlicher Erkrankungen • Blickwinkel primär auf (psychische) Krankheiten/ Störungen gerichtet |
| Gegenstand der Gesundheitspsychologie | • Körperliche und psychische Gesundheit |
| Definition 1 Gesundheitspsych: | Gesundheitspsychologie ist der wissenschaftliche Beitrag der Psychologie zur Förderung und Erhaltung von Gesundheit, Verhütung von Krankheit, Bestimmung von Risikoverhaltensweisen, Diagnose und Ursachenbestimmung von gesundheitlichen Störungen, Rehabilitation und Verbesserung des Systems gesundheitlicher Versorgung. (1990) |
| GesundheitspsychologieDefinition 2: | Gesundheitspsychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten der Menschen im Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit. Dabei stehen vor allem riskante und präventive Verhaltensweisen, psychische und soziale Einflussgrößen sowie deren Wechselwirkungen auf körperliche Erkrankungen und Behinderungen im Mittelpunkt. (2006) |
| Fragen, mit denen sich die Gesundheitspsychologie beispielsweise befasst: | • Warum werden manche Menschen krank, andere nicht? • Wie können HIV-Infektionen verhindert werden? • Wer erholt sich wie schnell von einem Herzinfarkt? • Wie lässt sich die Lebensqualität verbessern? • Allgemein: Wie beeinflussen Verhalten, Kognitionen, Emotionen, Motivation, Persönlichkeit, soziale Faktoren und das Gesundheitssystem die Gesundheit einer Person? |
| Anwendungsorientiert / Grundlagenfach | Gesundheitspsychologie ist einerseits ein anwendungsorientiertes Fach: Entwicklung und Evaluation von Gesundheitsförderungsprogrammen Andererseits beinhaltet sie auch Grundlagenforschung: Entwicklung theoretischer Modelle zB zu Stressbewältigung, subjektiven Krankheitstheorien, Risikowahrnehmung… |
| Interdisziplinär | Gesundheitspsychologie ist interdisziplinär ausgerichtet und integriert Befunde aus verschiedenen Bereichen, zB Sozialpsychologie, kognitive Psychologie, Entwicklungspsychologie… |
| Biomedizische Modell | In der Medizin herrschte lange Zeit das biomedizinische Modell vor: • Krankheit als naturwissenschaftlich objektivierbarer, oft von einer Norm abweichender Zustand • Ursachen von Krankheit sind genetische oder externe Faktoren (Bakterien, Viren, Gifte…) • Gesundheit = Abwesenheit von Krankheit |
| Basis der Gesundheitspsychologie ist NICHT das biomedizinische Modell, sondern das biopsychosoziale Modell: | • Krankheiten werden in einer Wechselwirkung von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren verursacht • Gesundheit und Krankheit als Endpunkte eines Kontinuums |
| Wann hat sich die Gesundheitspsychologie im deutschsprachigen Raum zunehmend als eigenständige Disziplin etabliert? | seit 1980er Jahren |
| Gründe für die Etablierung als eigenständige Disziplin: | • Massive Zunahme chronisch-degenerativer Erkrankungen • Entdeckung des Einflusses von Risikoverhalten auf Entstehung und Verlauf dieser Krankheiten • Kostenexplosion im Gesundheitswesen |
| Abgrenzung zur Verhaltensmedizin | interdisziplinäres Arbeitsfeld, in dem Gesundheits- und Krankheitsmechanismen unter Berücksichtigung psychosozialer, verhaltensbezogener und biomedizinischer Wissenschaften erforscht werden und die empirisch geprüften Erkenntnisse und Methoden in Prävention, Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation eingesetzt werden1 ; enge Beziehung zu Medizin |
| Abgrenzung zur Psychosomatik | beschäftigt sich wie die Gesundheitspsychologie mit der Verbindung biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren von Krankheiten, ist aber überwiegend krankheits- und behandlungsorientiert |
| Abgrenzung zur Medizinpsychologie | beschäftigt sich mit der gezielten Anwendung psychologischer Erkenntnisse und Modelle in der Medizin; Schwerpunkte sind zB die ArztPatienten-Beziehung, aber auch Gesundheitsförderung und Prävention |
| Abgrenzung zu Public-Health (Gesundheitswissenschaften) | hat die Ziele Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung, Lebensverlängerung, Förderung des Wohlbefindens, verwendet aber gemeindebezogene Maßnahmen, zB die Beeinflussung von Gesundheitssystemen |
| Verschiedene Definitionen von Krankheit/Störung: | • Krankheit als Schädigung (Pathologie) • Krankheit als Funktionseinschränkung • Krankheit als Leidenszustand • Krankheit als das, was Ärzte behandeln • Krankheit als Stressanpassung • Krankheit als Unvollkommenheit • Krankheit als eigene Schuld • Krankheit als Strafe für Sünde • Krankheit als Besessenheit (von etwas Bösem) • Krankheit als statistische Normabweichung • Krankheit als Begriff |
| Was gilt für die Begriffe Krankheit/Störung/Gesundheit? | Sind keine absoluten Begriffe, sondern welche, deren Bedeutung in verschiedenen Zeiten und Kontexten immer wieder neu verhandelt werden müssen. zB Ist jemand, der eine genetische Prädisposition für eine Krankheit hat, krank? |
| Definition von "Gesunheit" der WHO (1946): | Gesundheit ist ein Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und daher weit mehr als die bloße Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen. (Krankheit bedeutet hier Abwesenheit von Gesundheit, nicht umgekehrt!) |
| Kritik an der Definition der WHO | • Gesundheit ist kein Zustand, sondern ein kontinuierlicher Adaptationsprozess • WHO-Definition beinhaltet kein realistisches, sondern ein idealistisches Ziel |
| Wer entwickelte Wann das Modell der Salutogenese? | A. Antonovsky (1979): forderte komplementär zur bis dahin pathogenetisch orientierten Theoriebildung die Entwicklung von Modellen über Entstehung und Erhaltung von Gesundheit |
| Was ist das Modell der Salutogenese? | Gesundheit und Krankheit nicht als dichotome Gegensätze, sondern als Kontinuum mit den Endpunkten „Health-Ease” und „DisEase” (HEDE-Kontinuum)Da Gesundheit als Prozess aufgefasst wird, ist eine Person nicht „gesund“ oder „krank“ , sondern befindet sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Stelle auf dem HEDE-Kontinuum. Für die Lokalisation der aktuellen Position eines Individuums sind wesentlich: • Ausprägung von Schmerzen und funktionellen Beeinträchtigungen, • Notwendigkeit präventiver/kurativer Maßnahmen • Prognostische Einschätzung durch ExpertInnen des Gesundheitssystems |
| Was ist der Kohärenzsinn? | Antonovsky entwickelte das Modell über die folgenden Jahre immer weiter. Zum zentralen Bestandteil wurde der Kohärenzsinn. Darunter versteht Antonovsky die grundsätzliche Fähigkeit jedes Individuums, sich aus der Umwelt jene Elemente nutzbar zu machen, die dem Aufbau der eigenen Struktur förderlich sind, und jene Elemente zu meiden, die diese Struktur gefährden. |
| Was sind die Vorteile des Kohernzsinnes? | Ein gut ausgebildeter Kohärenzsinn ermöglicht bzw. erleichtert die Nutzung von protektiven Faktoren wie sozialen Bindungen, Wissen oder materiellen Gütern und ist somit wesentlicher Bestandteil der ständigen Erzeugung von Gesundheit. Ein starker Kohärenzsinn äußert sich als grundlegendes Gefühl der Zuversicht; die innere und äußere Welt werden als verständlich, Ereignisse als grundsätzlich bewältigbar und die eigene Existenz und das eigene Handeln als sinnvoll erlebt. |
| Umweltebene: | Gesundheitsförderliche vs gesundheitsbeeinträchtigende Umwelten Soziales Umfeld/soziale Unterstützung, Arbeitsbedingungen, Wohnsituation, ökologische Qualität der Umwelt usw usw |
| Individuelle Ebene: | Gesundheitsförderliche vs gesundheitsbeeinträchtigende Personenfaktoren Körperliche Faktoren (zB Gewicht, Blutdruck), Persönlichkeitsmerkmale (zB Optimismus, Selbstwert, Kohärenzsinn), Kognitionen (zB Kontrollüberzeugung), Verhaltens-weisen/Verhaltensmuster (zB Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung) usw usw |
| Beispiele für Gesundheitsempfehlungen | Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (gültig bis 2005) Österreichische Ernährungspyramide (BM f. Gesundheit, 2010) |
| Pest: | durch das Bakterium Yersinia pestis verursachte Infektionskrankheit, die in mehreren Varianten auftreten kann; besonders häufig als Beulenpest oder Lungenpest Geschichte: 1. nachgewiesene Pandemie 541-700 n.Chr. 2. Pandemie „Schwarzer Tod“ (1347-ca. 1353), rund 25 Millionen Tote Letzte Epidemien in Europa im 18. Jhdt 3. Pandemie 1896-ca. 1945, rund 12 Millionen Tote vor allem in Asien und Indochina Auch heute noch nicht ausgerottet, immer wieder Epidemien, zB seit 2008 in Madagaskar |
| Vermutete Ursachen der Pest im Wandel der Zeit | Griechische Antike: göttliche Pestpfeile (zB in Homers Ilias: Apoll schickt die Pest ins Lager der Griechen) Mittelalter: Medizin basierte auf Lehren der Antike sowie zB Astrologie; medizinische Theorien: • Pest als Fehlmischung der 4 Galen‘schen Körpersäfte (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle) • Miasmentheorie: faul riechende Winde oder Dämpfe aus dem Erdinneren verbreiten die Krankheit („Pesthauch“) • Astrologie: ungünstige Dreierkonstellation Saturn-Jupiter-Mars • Frühes 16. bis frühes 19. Jhdt: Contagiontheorie (Krankheitsübertragung durch Körperkontakt) |
| Empfehlungen zur Prävention im Wandel der Zeit | • Göttliche Pestpfeile Götter nicht erzürnen • Miasmentheorie Fenster nur nach Norden öffnen; feuchtschwüles Klima, Südwind und die Luft über stehenden Gewässern vermeiden; Schutz gegen Pesthauch durch Verbrennen von Kräutern, offene Feuer; Schutzmasken für Ärzte • Astrologisch ungünstige Konstellation keine • Contagiontheorie Körperkontakt vermeiden, Essigwaschungen, regelmäßig Wäsche wechseln • Quarantäne (Ursprung unklar) |
| Mittelalter ̶nicht-medizinische Theorien: (Pest) | • Pest als Strafe Gottes gottgefälliger Lebenswandel; Fasten, Enthaltsamkeit; Buße tun, zB Selbstgeißelung; >60 Pestheilige • Zuschreibung der Schuld an gesellschaftliche Randgruppen, zB jüdische Händler mehrfache Judenpogrome |
| Modernes Verständnis: (Pest) | 1894: A. Yersin identifiziert den Erreger der Pest 1898: P.-L. Simond klärt den Übertragungsweg von der Ratte über den Rattenfloh zum Menschen • 2. Übertragungsweg: Tröpfcheninfektion Mensch-Mensch, wenn Lunge befallen • Behandlung: mit Antibiotika; bei frühem Behandlungsbeginn gute Prognose • Prävention: öffentliche Hygiene – Entsorgung von Müll und Unrat entzieht Ratten die Lebensgrundlage; Bau von Häusern aus Stein • Impfung: mehrere Impfstoffe entwickelt, aber kein Impfschutz gegen Lungenpest, kurze Wirksamkeit, erhebliche Nebenwirkungen |
| Welche Schritte waren notwendig, um zu wirkungsvollen Empfehlungen zur Prävention zu gelangen? | • Beschreibung der Krankheit (welche Symptome gehören zusammen, welche gehören nicht dazu) • Entwicklung der notwendigen Technologien • Entdeckung des Erregers • Entdeckung des Übertragungsweges • Entdeckung des 2. Übertragungsweges • Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion der Übertragungswahrscheinlichkeit • (Entwicklung von Impfstoffen) |
| Historische Entwicklung von Ernährungsempfehlungen am Beispiel USA: | Anfang des 20. Jhdts: erste Empfehlungen zur gesunden Ernährung für Kinder, später Erwachsene; Fokus auf „schützenden“ Nahrungsmitteln 1943: „Basic Seven“ (siehe Abb. weiter vorne) – sollte Versorgung mit allen wichtigen Nährstoffen sicherstellen 1956: „Basic Four“ (Milchprodukte, Brot/Getreide, Obst/Gemüse, Fleisch) – Basisversorgung, mit Mengenangaben 1977: Dietary Guidelines for Americans mit genauen Prozentangaben für jede Nahrungsmittelgruppe; seither mehrfach aktualisiert 1984: Ernährungskreis 1992: Ernährungspyramide |
| Wer setzt Ernährungsziele? | Spiekermann (2000): „Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien versuchen auf eigene, gleichwohl eng miteinander verwobene Weise die jeweils rechte Ernährung vorzugeben.“ 1881: Voit‘sches Kostmaß – ermittelte Energieverbrauch von Menschen und leitete optimale Versorgung ab (Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate in ausreichender Menge und richtiger Zusammensetzung); großer Einfluss auf Politik |
| Verschiedene Motive für die Vorgabe von Ernährungszielen durch die Politik: | notwendige Rationierung knapper Lebensmittel; der Bürger als Arbeitskraft, als Soldat, als Belastung für das Gesundheitssystem…; Umgang mit Nahrungsmangel vs Umgang mit Nahrungsüberfluss |
| Wie kann man Zusammenhänge zwischen Ernährung und Erkrankungen bei Menschen wissenschaftlich untersuchen? | Mit epidemiologischer Forschung! |
| Nurses‘ Health Study | Eine der größten epidemiologischen Kohortenstudien zu Gesundheitsfragen 3 Phasen |
| 3 Phasen der Nurses' Health Study | Seit 1970: Ziel = Identifikation von Langzeit-Risikofaktoren für Krebs und kardiovaskuläre Erkrankungen bei Frauen 122.000 Teilnehmerinnen (90% noch immer in der Studie!) Seit 1989: Ziel = Untersuchung des Einflusses von Ernährung und Lebensstil 116.000 Teilnehmerinnen (90% noch immer in der Studie!) Seit 2010: Ziel = Untersuchung der Bereiche Lebensstil, Fortpflanzung, Umwelt und Arbeitsrisiken |
| Nurses‘ Health Study – Stichprobe Phase 1: | • Öffentliches Register von Krankenschwestern; 11 bevölkerungsreichste US-Bundesstaaten (California, Connecticut, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Texas); • Verheiratete lizenzierte Krankenschwestern, die 1976 30-55 Jahre alt waren • Rund 238.000 Frauen erfüllten die Einschlusskriterien • 3-malige Aussendung der Fragebögen im Jahr 1976 • Insgesamt 65.000 Fragebögen nicht zustellbar; von den 172.000 zustellbaren wurden 122.000 ausgefüllt zurückgeschickt (71%)• Alle 2 Jahre Folge-Fragebogen mit Fragen zu Erkrankungen und zur Gesundheit, zB Rauchen, Einnahme von Hormonpräparaten • Ab 1980 zusätzlich alle 4 Jahre ein Fragebögen zum Ernährungsverhalten • Ab 1992 zusätzlich ein Fragebogen zur Lebensqualität • Zusätzlich verschiedene Spezial-Fragebögen an verschiedene Teilstichproben • Zusätzlich Proben (Blut, Harn…) von verschiedenen Teilstichproben zur Identifikation genetischer und anderer biologischer Marker |
| Nurses‘ Health Study – Stichprobe Phase 2: | • Mehr Infos zu Kindheit und Jugend • Schwerpunkt auf Einfluss von Hormonen in Jugend und frühem Erwachsenenalter |
| Nurses‘ Health Study – Stichprobe Phase 3: | • Komplett webbasiert • Auch mit anderen Gesundheitsberufen • Auch mit männlichen Krankenpflegern • Stärkere Berücksichtigung von ethnischer Diversität |
| Nurses‘ Health Study ̶Ergebnisse Ernährung (Auswahl) | • Alkoholkonsum erhöht das Risiko für Brustkrebs. • Mediterrane Ernährung senkt das Risiko für KHK und Schlaganfall, Transfette und raffinierte Kohlenhydrate erhöhen das Risiko. • Hoher Konsum von rotem Fleisch und Wurstwaren erhöht das Risiko für Darmkrebs. • Hoher Konsum von Gemüse, vor allem grünem Blattgemüse, senkt das Risiko eines kognitiven Abbaus im Alter. • Übergewicht erhöht das Risiko für postmenopausalen Brustkrebs, Darmkrebs, KHK und Schlaganfall. |
| Nurses‘ Health Study ̶andere Ergebnisse (Auswahl) | • Rauchen erhöht das Risiko für KHK, Schlaganfall, Darmkrebs, Hüftfrakturen und verschiedene Augenerkrankungen. • Während der Einnahme der „Pille“ ist das Risiko für Brustkrebs und für KHK und Schlaganfall erhöht; nach dem Absetzen normalisiert sich das Risiko wieder. • Die Einnahme einer Hormonersatztherapie in der Menopause erhöht ab einer bestimmten Dauer das Brustkrebsrisiko. • Bewegung senkt das Risiko für Brust- und Darmkrebs, verbessert das Überleben nach Brustkrebs, senkt das Risiko für KHK, Schlaganfall, Hüftfrakturen und für kognitive Beeinträchtigungen. |
| Probleme bei epidemiologischen Studien wie der Nurses‘ Health Study: | • Enorm aufwändig und teuer • Basiert großteils auf Selbstauskünften der TeilnehmerInnen; Angaben daher nur bedingt verlässlich • TeilnehmerInnen gehen mit der Zeit „verloren“ (fallen aus der Studie) • Wie weit können die Ergebnisse verallgemeinert werden? • Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge können nicht mit letzter Sicherheit festgestellt werden |
| Conclusio | Heutige Gesundheitsempfehlungen basieren zunehmend auf den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin, dh auf den Ergebnissen wissenschaftlicher Studien, deren Qualität nach definierten Maßstäben gesichert wird. Als Grundlage kommen, sofern bekannt, Ursache-WirkungsZusammenhänge (vgl. Pest) oder epidemiologisch gefundene statistische Zusammenhänge (vgl. Ernährung) in Frage. Der Stand der Forschung entwickelt sich in vielen Bereichen kontinuierlich weiter. In der Folge verändern sich auch Gesundheitsempfehlungen. Neben der Wissenschaft beeinflussen auch Politik, Wirtschaft und Medien die aktuellen Gesundheitsempfehlungen. |
| Basisdaten: Österreichs Bevölkerung in den 2010er-Jahren (1) | • 8,48 Millionen ÖsterreicherInnen • 2,35 Millionen Familien, davon 1,40 Millionen Familien (59,6%), in denen Kinder leben • 173.000 Ein-Eltern-Familien mit abhängigen Kindern <27 Jahren bzw. 113.000 mit Kindern <15 Jahren (Mütter: 104.000; Väter: 9.000) • Mittleres Alter bei der 1. Heirat: 32,2 Jahre bei Männern, 29,8 Jahre bei Frauen • 40,1% der Ehen werden wieder geschieden (Minimum: Kärnten 35,2; Maximum: Wien 46,4) |
| Basisdaten: Österreichs Bevölkerung in den 2010er-Jahren (2) | • Bevölkerung wuchs 2013 um rund 0,66% (55.926 Personen); Zuwachs ist auf den positiven Wanderungssaldo zurückzuführen (Geburtenbilanz leicht negativ) • 16% der in Österreich lebenden Personen sind in einem anderen Land geboren, in Wien 31% • Die Gesamtfruchtbarkeitsrate pro Frau liegt mit 1,44 (Spanne: 1,27-1,55) etwas unter dem EU-Durchschnitt mit 1,55 (Maximum: Irland und Frankreich 2,01, Minimum: Portugal 1,28). • Mediane Lebenserwartung für 2013 Geborene: 78,5 Jahren für männliche und 83,6 Jahren für weiblichen Babys • 5,24 Millionen Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 65 Jahren stehen 3,24 Millionen Menschen <20 und >65 Jahren gegenüber |
| Todesursachen | Die häufigste Todesursache sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (43%). Die zweithäufigste ist Krebs (25%). |
| Chronische körperliche Erkrankungen | • Krankheiten, die das Ergebnis eines längeren Prozesses degenerativer Veränderung sind; sowie • Krankheiten, die bleibende gesundheitliche Schäden oder Behinderung zur Folge haben Heilt eine Krankheit nicht aus oder kann ihre Ursache nicht beseitigt werden, kommt es zur Chronifizierung. Dabei können chronische Erkrankungen auch phasenhaft verlaufen, zB Rheumatoide Arthritis mit „Krankheitsschüben“. |
| Chronische körperliche Erkrankungen (1) | • Jede/r 3. ÖsterreicherIn gibt an, irgendwann einmal unter Wirbelsäulenbeschwerden gelitten zu haben (Männer 36%, Frauen: 39%). Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit des Auftretens dieses gesundheitlichen Problems an, unter den Über-75-Jährigen haben 47% der Männer und 52% der Frauen Wirbelsäulenbeschwerden. • Allergien (inkl. Asthma) sind ebenfalls relativ weit verbreitet: Jede fünfte Person ist davon betroffen, Frauen häufiger als Männer (24% bzw. 18%). Im Gegensatz zu anderen chronischen Krankheiten treten Allergien bei jungen Personen am häufigsten auf. |
| Chronische körperliche Erkrankungen (2) | • Große geschlechtsspezifische Unterschiede gibt es im Auftreten von Migräne oder häufigen Kopfschmerzen. Jede vierte Frau, aber nur jeder neunte Mann leidet unter diesem Gesundheitsproblem (Frauen: 26%, Männer: 11%). Am häufigsten ist die Altersgruppe der 45- bis 59-Jährigen betroffen (Frauen: 30%, Männer: 13%). • 6% der österreichischen Bevölkerung wissen, dass sie an Diabetes erkrankt sind, wobei die tatsächliche Prävalenz auf 8- 9% geschätzt wird. Der Anteil der Betroffenen nimmt mit dem Alter zu, wobei auch schon Kinder erkranken können. |
| Chronische körperliche Erkrankungen (3) | • Ein Fünftel der Bevölkerung berichtet einen erhöhten Blutdruck (gehabt) zu haben (Männer: 20%, Frauen: 23%). • 13% der Männer und 20% der Frauen sind von Arthrose, Arthritis und Gelenksrheumatismus betroffen. Während im jungen Erwachsenenalter kaum Personen über diese Gruppe von Krankheiten klagen, ist es bei den 45- bis 59-Jährigen bereits jeder 5., bei den 60- bis 74-Jährigen jeder 3. und bei den über 75-Jährigen jeder 2. Mensch. • Eine Erkrankung, die vor allem bei Frauen im höheren Alter auftritt, ist Osteoporose: Jede 4. Frau über 60 leidet an dieser Erkrankung des Bewegungsapparates, aber nur rund 4% der Männer in dieser Altersgruppe sind davon betroffen. |
| Psychische Erkrankungen | Eine Meta-Analyse ergab folgende 1-Jahres-Prävalenzen für Europa: • Angststörungen 14,0% • Affektive Störungen (Depression, Manie) insgesamt 7,8% • Somatoforme Störungen 6,3% • Alkoholabhängigkeit 3,4% • Anorexie 0,2-0,5%, Bulimie 0,1-0,9% • Nichtorganische Schlafstörungen 7,0% • Borderline-Persönlichkeitsst. 0,7%, Dissoziale Persönlichkeitsst. 0,6% • Demenzen 5,4% • ADHD 5,0% Insgesamt leiden jedes Jahr 27,4% der erwachsenen europäischen Bevölkerung am Vollbild einer psychischen Störung; das entspricht (unter Berücksichtigung der Komorbiditäten) 118 Mio. Menschen. |
| Suizidalität | • In Ö traditionell sehr hohe Suizidrate; in den letzten 30 Jahren aber kontinuierlich gesunken, derzeit bei 12,8 je 100.000 Einwohnern • In absoluten Zahlen bedeutet das, dass sich 2012 knapp 1.300 Menschen das Leben nahmen. Zum Vergleich: 2012 starben 550 Menschen durch Verkehrsunfälle. • Über alle Altersgruppen betrachtet, haben österreichische Männer ein >3x so hohes Suizidrisiko wie Frauen; in jüngeren Jahren und im hohen Alter ist dieses Verhältnis noch extremer. • Suizidrisiko steigt mit dem Alter bis in das hohe und höchste Alter: Suizidrisiko ab dem 85. Lebensjahr ist etwa 3x so hoch wie in der Durchschnittsbevölkerung • Zu Suizidversuchen liegen keine verlässlichen Zahlen vor, da sie oft nicht erkannt bzw. entsprechend dokumentiert werden. Internationalen Studien folgend, muss von 12.000-38.000 Suizidversuchen in Österreich pro Jahr ausgegangen werden. (2012) |
| Alkoholkonsum | • 5% der österreichischen Bevölkerung sind alkoholabhängig (7,5% der Männer, 2,5% der Frauen). Dazu kommen weitere 11% der Männer und 8% der Frauen, die Alkoholmengen trinken, die längerfristig ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen (Männer: 3/4l Wein oder 3/2l Bier; Frauen: 2/4l Wein oder 2/2l Bier). Insgesamt trinken 14% der Erwachsenen Alkohol in problematischem Ausmaß. • Fast die Hälfte der 15-jährigen Burschen und ein Drittel der 15- jährigen Mädchen haben schon Rauscherfahrungen. |
| Prävalenz psychischer Störungen bei österreichischen Jugendlichen: Studie von Wagner et al. (2017) | • Punktprävalenz für mind. 1 psychische Störung: 23,9%, Lebenszeitprävalenz: 35,8% (Angststörungen 15,6%; Störungen der neuronalen Entwicklung (zB Autismus) gesamt 9,3%, davon ADHD 5,2%; depressive Störungen 6,2%) • 47% mit einer Lebenszeit-Diagnose haben Zweitdiagnose • Internalisierende Störungen häufiger bei Mädchen, bei Burschen häufiger Störungen der neuronalen Entwicklung sowie disruptive, Impulskontroll- und Verhaltensstörungen • 48% mit Lebenszeit-Diagnose hatten Kontakt mit „Mental Health Services“ , weitere 18% hätten Interesse daran |
| Was können wir selbst beitragen, um körperlich und psychisch gesund zu bleiben? | • Ernährung spielt eine wichtige Rolle in der Entstehung vieler Krankheiten, zB Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bestimmte (nicht alle) Arten von Krebs, Diabetes… • Wichtig sind Quantität und Qualität, also wieviel und was wir essen • Die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Krankheit können sein: – Direkt (zuviel oder zuwenig bestimmter Inhaltsstoffe), – Indirekt (zuviel essen → Übergewicht → Krankheitsrisiko) – Oder beides (zB Diabetes Typ II: Risiko ist durch falsche Ernährung auch bei Normalgewichtigen erhöht, aber Übergewicht steigert das Risiko nochmals) |
| Österreichische Ernährungspyramide (BM f. Gesundheit, 2010) | 7 Ebenen |
| Ebene 1: Fettes, Süßes und Salziges | Max. eine Portion süßer oder fetter Snacks pro Tag Besser Kräuter und Gewürze statt Salz verwenden, stark gesalzene Lebensmittel vermeiden |
| Ebene 2: Fette und Öle | Täglich 1-2 Esslöffel pflanzliche Öle, Nüsse oder Samen; Qualität vor Menge Hochwertige pflanzliche Öle sowie Nüsse und Samen enthalten wertvolle Fettsäuren und können daher in moderaten Mengen täglich konsumiert werden. Streich-, Back- und Bratfette wie Butter, Margarine oder Schmalz und fettreiche Milchprodukte wie Schlagobers, Sauerrahm, Crème Fraîche sparsam verwenden |
| Ebene 3: Fisch, Fleisch, Wurst und Eier | Pro Woche mind. 1-2 Portionen Fisch (je 150 g), bevorzugt fettreichen Seefisch (zB Makrele, Lachs, Thunfisch, Hering) oder heimischen Kaltwasserfisch (zB Saibling) Pro Woche max. 3 Portionen fettarmes Fleisch oder fettarme Wurstwaren (300-450 g pro Woche). Rotes Fleisch (zB Rind, Schwein und Lamm) und Wurstwaren eher selten essen. Pro Woche max. 3 Eier (diese Empfehlung wird evtl. in der nächsten Zeit weniger strikt) |
| Ebene 4: Milch und Milchprodukte | Täglich 3 Portionen Milch und Milchprodukte, bevorzugt fettarme Varianten. 1 Portion entspricht: 200ml Milch , 180-250g Joghurt, 200g Topfen oder Hüttenkäse, 50-60g Käse. Optimal sind 2 Portionen „weiß" (zB Joghurt, Buttermilch, Hüttenkäse) und 1 Portion „gelb" (Käse) |
| Ebene 5: Getreide und Erdäpfel | Täglich 4 Portionen Getreide, Brot, Nudeln, Reis oder Erdäpfel (5 Portionen für sportlich Aktive und Kinder). 1 Portion entspricht: 50-70g Brot/Gebäck, 50-60g Müsli/ Getreideflocken, 200-250g Teigwaren (gekocht), 150-180g Reis/Getreide (gekocht), 3-4 mittelgroßeErdäpfel; bevorzugt Produkte aus Vollkorn |
| Ebene 6: Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst | Täglich 5 Portionen Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst; ideal sind 3 Portionen Gemüse/Hülsenfrüchte und 2 Portionen Obst. 1 Portion entspricht: 200-300g Gemüse (gegart), 100-200g Rohkost, 75-100g Salat, 150-200g Hülsenfrüchte (gekocht), 125-150g Obst, 200 ml Gemüse- oder Obstsaft. Faustregel: Eine geballte Faust entspricht einer Portion Obst, Gemüse oder Hülsenfrüchte. Gemüse zum Teil roh essen, das saisonale und regionale Angebot beachten |
| Ebene 7: Alkoholfreie Getränke | Täglich mind. 1,5 Liter Flüssigkeit, bevorzugt energiearme Getränke: Wasser, Mineralwasser, ungezuckerte Früchte- oder Kräutertees, verdünnte Obst- und Gemüsesäfte Gegen den täglichen moderaten Konsum von Kaffee/ Schwarztee (3-4 Tassen) und anderen koffeinhaltigen Getränken ist nichts einzuwenden |
| Übergewicht bzw. Adipositas erhöhen das Risiko für: | • Arteriosklerose • Bluthochdruck • Erhöhten Cholesterin-Spiegel • Herz-Kreislauf-Erkrankungen • Diabetes mellitus Typ II • Brust-, Dickdarm-, Gebärmutter- und Nierenkrebs • Gicht • Gallensteine • Schlaf-Apnoe-Syndrom • Gelenkserkrankungen, zB Arthrosen |
| Wann erkranken Übergewichtige? | Nicht jede/r Übergewichtige wird krank. Das Krankheitsrisiko steigt mit Höhe und Dauer des Übergewichts. Die Körperform („Apfel-/Birnentyp“) hat ebenfalls Einfluss. |
| Das Adipositas-Paradoxon | Mehrere Meta-Analysen zeigen, dass leichtes Übergewicht (BMI 25-30) zwar das Krankheitsrisiko insgesamt erhöht, aber die Sterblichkeit etwas verringert. Starkes Übergewicht (Adipositas, BMI >30) erhöht sowohl das Krankheitsrisiko als auch die Mortalität. Gründe: nicht eindeutig geklärt |
| Trinken | • Zu geringe oder zu hohe Flüssigkeitsaufnahme spielt de facto in der gesunden Allgemeinbevölkerung keine große Rolle in der Krankheitsentstehung (Ausnahmen: Säuglinge und Kleinkinder zB bei Fieber, Menschen mit bestehender Vorerkrankung der Nieren oder Neigung zu Blasenentzündung) • Berichtet wird von besserem subjektiven Wohlbefinden, höherer Leistungsfähigkeit • Ausnahme: Im hohen Alter lässt bei vielen Personen das Durstgefühl nach; zu geringe Flüssigkeitszufuhr erhöht das Risiko für Verwirrtheitszustände (Delir) erheblich! |
| Akute Räusche (Alkohol) | sind mit Gefahren wie Ersticken, Erfrieren verbunden |
| Langfristiger Alkoholkonsum in hohen Mengen: | • Führt zu Alkoholabhängigkeit • Ist mit erhöhtem Risiko für Bluthochdruck, Übergewicht, Schädigungen von Organen wie der Leber oder Bauchspeicheldrüse, Beeinträchtigungen der Potenz verbunden • Erhöht das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen (wie Mund-, Rachen-, Speiseröhren- oder Brustkrebs |
| Extremer und chronischer Alkoholkonsum: | kann zu schweren Schädigungen des Gehirns führen, bis hin zu Delir, Demenz, Persönlichkeitsveränderungen etc |
| Alkohol | Ob bzw. in welcher Form mäßig genossener Alkohol positive Wirkungen auf die Gesundheit hat, ist umstritten; es gibt zB Hinweise auf einen günstigen Effekt bestimmter Inhaltsstoffe (Resveratrol…) von Rotwein auf die Blutgefäße. Jedenfalls ist Alkohol besonders dann schädlich, wenn er extrem und/oder chronisch konsumiert wird. Während einer Schwangerschaft sind auch geringe Alkoholmengen mit einem Risiko für Fehlbildungen des Kindes verbunden (FASD = Fetal Alcohol Spectrum Disorders)! |
| Rauchen & Krebs | Rund ein Viertel aller Krebstodesfälle sind auf die Folgen des Rauchens zurückzuführen. RaucherInnen haben ein doppelt so hohes Krebsrisiko wie NichtraucherInnen. Rauchen ist der wichtigste vermeidbare Risikofaktor der Krebsentstehung. Das Krebsrisiko ist umso höher, je früher man mit dem Rauchen beginnt, je mehr Zigaretten man täglich konsumiert und je länger man raucht. Lungenkrebs ist bei RaucherInnen die häufigste Krebserkrankung. Rauchen erhöht auch das Risiko für Krebserkrankungen der Bronchien, des Kehlkopfs, des Mund-, Nasen- und Rachenraums, der Speiseröhre, der Leber, der Bauchspeicheldrüse, der Nieren, des Blutes, der Harnblase, der Brust sowie des Gebärmutterhalses. |
| Rauchen & andere Erkrankungen | • Rauchen ist eine der wichtigsten vermeidbaren Ursachen für die Entstehung von Arteriosklerose. Diese kann zu einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (zB Raucherbein) führen. • Rauchen ist die häufigste Ursache für COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung). 90% der an COPD erkrankten Personen sind (Ex-)RaucherInnen. • Die Haut altert bei RaucherInnen vorzeitig. Rauchen begünstigt Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder Akne. • Frauen, die während der Schwangerschaft rauchen, haben ein erhöhtes Risiko für Komplikationen; weiters bestehen Risiken für das Kind, zB für ein niedriges Geburtsgewicht. • Rauchen erhöht das Risiko für Zahnerkrankungen. • Rauchen ist ein Risikofaktor für Erektionsprobleme (Männer) und Fruchtbarkeitsstörungen (Männer und Frauen). |
| Nichtrauchen | Nichtrauchen ist eine der effektivsten Verhaltensweisen, um die eigene Gesundheit zu erhalten. |
| Ein Rauchstopp hat folgende Wirkungen: | • Nach 20 Minuten sinken Puls und Blutdruck auf normale Werte. • Nach acht Stunden sinkt der Kohlenmonoxidspiegel im Blut, und die Sauerstoffwerte im Blut normalisieren sich. • Nach zwei Tagen ist der Körper frei von Nikotin, Geschmacks- und Geruchssinn verbessern sich. • Nach drei Tagen kann man besser atmen. • Nach zwei Wochen bis drei Monaten verbessert sich der Kreislauf. • Nach ein bis neun Monaten gehen Hustenanfälle und Kurzatmigkeit zurück, und die normale Lungenfunktion ist wieder erreicht. • Nach einem Jahr ist das Risiko eines Herzinfarkts nur noch halb so groß wie bei einer Raucherin/einem Raucher. • Nach zehn Jahren ist das Lungenkrebsrisiko nur noch halb so groß wie wie bei einer Raucherin/einem Raucher |
| Gesundheitlicher Nutzen ausreichender körperlicher Bewegung: | • Körpergewicht sinkt (bei gleichbleibender Ernährung) • Herz-Kreislauf-System wird leistungsfähiger • Blutdruck sinkt • Fettstoffwechsel verbessert sich • Zuckerstoffwechsel verbessert sich • Muskelkraft verbessert sich • Knochendichte nimmt zu • Stützfunktion, Stabilität verbessert sich • Beweglichkeit, Belastbarkeit der Gelenke nimmt zu • Immunabwehr verbessert sich • Gehirnfunktionen verbessern sich • Psyche: antidepressive Wirkung |
| Bewegung senkt das Risiko für viele weitverbreitete Erkrankungen sowie Verletzungen: | • Herz-Kreislauf-Erkrankungen • Schlaganfall • Übergewicht und Fettleibigkeit • Diabetes Typ II • Krebs (vor allem Darm-, Lungen-, Brust-, Prostatakrebs) • Depression • Demenz • Infektionserkrankungen • Hüftfrakturen • Stürze |
| Optimale Wirkung (Bewegung) | Auch bei Bewegung hängt die optimale Wirkung von der Dosis ab, Überdosierung schadet auch beim Sport, zB der Herzgesundheit. |
| Prävention psychischer Störungen: | Günstige Verhaltensweisen wurden bisher fast ausschließlich im Rahmen von Interventionsstudien erforscht (zB angeleitete Trainingskurse), nicht im Sinn von Selbstanwendung |
| Was wirkt (auf individueller Ebene)? | • Förderung von Resilienz • Förderung der Stressverarbeitungskompetenz • Förderung der Konfliktlösefähigkeiten • Förderung von Selbstfürsorge • Förderung von Selbstwirksamkeit • Stärkung des sozialen Netzes • Früherkennung von erhöhtem Risiko, gezielte Hilfe (zB Suizidprophylaxe, Healthy Aging) |
| Allgemein bekannte Faktoren, die für die psychische Verfassung förderlich sind: zB | • Soziale Unterstützung/Integration • Als sinnhaft erlebte Tätigkeiten • Balance zwischen „Sollen“ und „Wollen“ • Ausreichend Bewegung |
| Mögliche Zusammenhänge Ernährung/Darmflora/Psyche: | • Veränderte Darmflora bei Posttraumatischer Belastungsstörung, Depression, Angststörungen • Unter Stress kann Vielfalt nützlicher Darmbakterien reduziert sein; Darmschleimhaut wird durchlässiger, mehr Antigene gelangen hindurch; Immunzellen schlagen Alarm, rufen Entzündungsreaktionen hervor; entzündungsfördernde Zytokine werden produziert; diese wirken auch auf das Gehirn • Im Darm erfolgtauch großer Teil der Serotoninproduktion |
| Warum ist es für viele Menschen so schwierig, sich gesundheitsförderlich zu verhalten? | Ein Hauptproblem besteht darin, dass die Belohnung für das Verhalten nicht unmittelbar eintritt Gratifikationsaufschub! |
| Das Marshmallow-Experiment | In den 1960er-Jahren entwickelte W. Mischel ein Experiment, um die Fähigkeit von 4-5jährigen Kindern zum Belohnungsaufschub zu untersuchen. Die Kinder bekamen ein Marshmallow und konnten sich entscheiden: Entweder sie aßen es gleich, oder sie warteten 15 Minuten und bekamen ein zweites dazu. Diejenigen Kinder, die lange warten konnten, waren 10 Jahre später im Durchschnitt schulisch erfolgreicher, konnten besser mit Frustrationen umgehen, waren selbstbewusster etc. 20 Jahre später hatten sie eine bessere Ausbildung, stabilere Beziehungen, nahmen seltener Drogen, waren seltener übergewichtig etc. |
| Neuropsychologische Grundlage (des Marshmellow Experiments) | Das Limbische System ist Sitz von Emotionen und instinktiven Reaktionen („Hot System“); auf einen Appetitreiz reagiert es mit dem Impuls zu essen. Der Präfrontale Cortex ist Sitz der Imagination, der Impulskontrolle und der Fähigkeit, sich die Zukunft vorzustellen („Cool System“) – der Impuls zu essen kann zurückgehalten werden, indem der Präfrontale Cortex das Limbische System „überstimmt“. Die Fähigkeit zum Gratifikationsaufschub ist trainierbar! Die Selbstkontrolle kann durch eine Vielzahl von Strategien verbessert werden. |
| Verhalten vs. anderen Faktoren | Zusammenfassend kann man sagen, dass unser Verhalten unsere Gesundheit in vielerlei Hinsicht beeinflusst. |
| Sind wir also alles in allem allein für unsere Gesundheit verantwortlich? | Nein! |
| Einfluss auf die Gesundheit haben neben unserem Gesundheitsverhalten auch: | • Soziale Beziehungen, sozialer Status • Medizinische Versorgung, Hygiene • Sozioökonomische Faktoren: existenzielle Sicherheit, Armut/Reichtum, Ausprägung der sozialen und ökonomischen Ungleichheit • Schwierige frühe Kindheit (Auswirkung auf Stressverarbeitung) • Und anderes mehr |
| Europäischer Kodex zur Krebsbekämpfung | 1. Rauchen Sie nicht. Wenn Ihnen dies nicht gelingt, rauchen Sie nicht in Anwesenheit von Nichtrauchern, vor allem Kindern. 2. Vermeiden Sie Übergewicht. 3. Bewegen Sie sich täglich. 4. Essen Sie mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Essen Sie wenig tierisches Fett. 5. Beschränken Sie Ihren Alkoholkonsum auf maximal 2 Gläser/Tag als Mann bzw. auf 1 Glas/Tag als Frau. 6. Vermeiden Sie übermäßige Sonnenbestrahlung. Besonders Kinder und Jugendliche müssen geschützt werden. 7. Halten Sie genauestens Vorschriften ein, die Sie vor einer Exposition gegenüber bekannten krebserregenden Stoffen schützen sollen. |
| Gesundheitsverhalten: | Verhaltensweisen, die (nach dem Stand der Forschung) die körperlichen, psychischen, sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Dimensionen der Gesundheit einer Person direkt oder indirekt fördern bzw. aufrechterhalten und Krankheiten vorbeugen – unabhängig von der Motivation der Person sowie davon, ob diese bewusst, unbewusst oder automatisiert ablaufen; auch Reduktion bzw. Modifikation von gesundheitsbeeinträchtigenden Verhaltensweisen1 zB körperliche Aktivität, Ernährung, Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen, Rauchstopp… |
| Risikoverhalten: | Verhaltensweisen, die kurz-, mitteloder langfristig die Gesundheit einer Person gefährden oder beeinträchtigen bzw. das Entstehen von Krankheiten fördern – direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst, intendiert oder nicht intendiert; auch Unterlassen von gesundheitsförderlichem Verhalten1 zB Alkohol- und Drogenmissbrauch, suboptimaler Umgang mit Diabetes… |
| Modelle des Gesundheitsverhaltens | • Kontinuierliche Modelle: Person befindet sich auf Kontinuum der Verhaltenswahrscheinlichkeit; Wahrscheinlichkeit zu handeln hängt von Ausprägung bestimmter kognitiver bzw. affektiver Variablen ab • Dynamische Stadienmodelle: Person durchläuft während Verhaltensänderung verschiedene Stadien, die sich qualitativ unterscheiden |
| • Kontinuierliche Modelle: | Health-Belief-Modell (Rosenstock, 1966 etc) Sozial-kognitive Theorie (Bandura, 1977, 1986) Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) Volitionale Modelle |
| • Dynamische Stadienmodelle: | Transtheoretisches Modell der Verhaltensänderung (TTM, Prochaska & DiClemente, 1983) Prozessmodell gesundheitlichen Handelns (HAPA, Schwarzer, 1992) |
| Kontinuierliche Modelle des Gesundheitsverhaltens Grundannahme: | Kognitionen von zentraler Bedeutung, ob sich Individuum gesundheitsförderlich verhält oder nicht; Gesundheitsverhalten wird speziell von folgenden Faktoren beeinflusst: 1. Erlebte Bedrohung durch eine Krankheit a) Subjektive Vulnerabilität b) Schweregrad einer Erkrankung/antizipierte Folgen 2. Wahrgenommenen Wirksamkeit der gesundheitsförderlichen Verhaltensweise a) Subjektiver Nutzen b) Subjektive Kosten Revidiertes Modell1 : 3. Gesundheitsmotivation: Bereitschaft, sich um gesundheitliche Fragen zu kümmern Modifizierende Faktoren: soziodemographische Variablen, Persönlichkeitsvariablen und handlungsaktivierende Variablen (zB Gesundheitskampagnen, Wahrnehmung von Krankheitssymptomen) |
| Voraussetzung für realistische Einschätzungen: | adäquate Vorinformationen Günstig: Erfahrungen mit Gesundheitsverhalten (zB Sport wird bei regelmäßiger Ausübung positiv erlebt) |
| Forschungsergebnisse (Health-Belief-Modell) | Erlebte Bedrohung und wahrgenommene Wirksamkeit haben keinen hohen Vorhersagewert für Gesundheitsverhalten (zB erzeugt subjektive Vulnerabilität Angst, und zwischen Angst und Handlungswahrscheinlichkeit besteht ein U-förmiger Zusammenhang) |
| Forschungsergebnisse zur subjektiven Risikoeinschätzung | ZB „optimistischer Fehlschluss“: In >100 Studien wurde gezeigt, dass Menschen ihr eigenes Erkrankungsrisiko geringer einschätzen als jenes vergleichbarer (!) Mitmenschen |
| Sozial-Kognitive-Theorie (Grundannahme) | Kognitive, motivationale, emotionale und aktionale Prozesse werden durch subjektive Erwartungen gesteuert, vor allem durch Selbstwirksamkeits- und Handlungsergebniserwartungen Handlungsergebniserwartungen: Welche positiven und negativen Konsequenzen würden die verschiedenen Handlungsalternativen haben? Selbstwirksamkeit(serwartungen): Glaube ich, dass ich es schaffen werde, ein Verhalten tatsächlich umzusetzen? |
| Studienergebnisse: Personen mit höherer Selbstwirksamkeit … | … setzen sich höhere Ziele. … beginnen Handlungen schneller. … strengen sich mehr an. … geben nicht so schnell auf. … erholen sich schneller von Rückschlägen. Selbstwirksamkeit ist in diesem Modell bereichsspezifisch! |
| Wie kann Selbstwirksamkeit gefördert werden? | 1. Erfahrung, dass eine Handlung erfolgreich ausgeführt wurde (und die Ursache für den Erfolg in der eigenen Person gesehen wird) 2. Stellvertretende Erfahrung anhand eines „Modells“ 3. Symbolische Erfahrung (Stärkung durch das Vertrauen anderer) 4. Emotionale Erregung kann die Selbstwirksamkeitserwartung senken |
| Theory of Planned Behavior (TPB) | Die TPB entstammt der Sozialpsychologie und ist eine Erweiterung der Theory of Reasoned Action/Theorie der Handlungsveranlassung (Fishbein & Ajzen, 1975), die den Zusammenhang zwischen Einstellung und Handlung untersuchte und als Zwischenglied die Intention postulierte. Intention: bewusste Entscheidung einer Person, ein bestimmtes Verhalten auszuführen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen; gemäß der Theorie bester Prädiktor des Verhaltens |
| Die Intention ist von 3 Faktoren abhängig: | • Von der Einstellung gegenüber dem Verhalten, dh seine affektiv getönte Bewertung • Von den sozialen Normen (Erwartung, wie nahestehende Personen das geplante Verhalten der Person bewerten würden) • Von der wahrgenommene Verhaltenskontrolle (Erwartung, wie einfach oder schwierig die Ausführung des geplanten Verhaltens wird) |
| Beispielfragen (nach dem Schulnotenprinzip zu beantworten) - TBP | • Einstellung: Regelmäßig Sport zu betreiben ist für mich (1) angenehm bis (5) unangenehm. • Soziale Normen: Mein Partner findet, dass ich (1) unbedingt bis (5) keinesfalls regelmäßig Sport betreiben sollte. • Wahrgenommene Verhaltenskontrolle: Regelmäßig Sport zu betreiben ist für mich (1) sehr gut möglich bis (5) völlig unmöglich. |
| Forschungsergebnisse: (TPB) | • Die sozialen Normen haben meist den geringsten Effekt (weil sie zu allgemein erfasst werden?) • In vielen Studien zu verschiedenen Gesundheitsbereichen gelang Vorhersage der Intention gut, die Vorhersage des Verhaltens deutlich schlechter. |
| Die Intentions-Verhaltens-Lücke (Problem) | Die Intention kann das tatsächliche Gesundheitsverhalten nur zu 20-30% erklären. |
| Es muss einen Zwischenschritt zwischen Intention und Handlung geben! Unterscheidung zwischen: | Motivation = Prozess der Bildung einer Intention Volition = Prozess der Umsetzung der Intention in konkretes Handeln Es reicht daher auch nicht aus, Menschen zu motivieren – man muss sie auch in der Umsetzung unterstützen! |
| Volitionale Modelle | Mehrere Modelle, die sich spezifisch mit der Umsetzung von Intention in Handlung befassen Wichtige Faktoren dabei sind zB: Handlungs- oder Ausführungsplanung (zB „Um mehr Obst zu essen, werde ich jeden Tag im Büro am Vormittag einen Apfel essen.“) Bewältigungsplanung („Welche Schwierigkeiten könnte ich dabei haben? Wie kann ich damit umgehen?“) |
| Dynamische Stadienmodelle des Gesundheitsverhaltens | Transtheoretisches Modell (TTM) Prozessmodell gesundheitlichen Handelns |
| Das Transtheoretisches Modell (TTM) postuliert 6 Stufen der Verhaltensänderung: | 1. Präkontemplation: In den nächsten 6 Monaten werde ich mein Verhalten sicher nicht ändern. 2. Kontemplation: Hm, also noch nicht nächsten Monat… aber ich denke schon darüber nach, mein Verhalten zu ändern. Was hätte das für Vorteile und Nachteile? 3. Vorbereitung: Jetzt geh‘ ich‘s an! 4. Handlung: Ich habe mein Verhalten vor kurzem geändert. 5. Aufrechterhaltung: Ich übe seit 6 Monaten mein neues Verhalten aus und will auch weiter nicht rückfällig werden. 6. Stabilisierung: Jetzt ist es schon 5 Jahre her, dass ich mein Verhalten geändert habe! Ich werde sicher nicht mehr rückfällig. |
| Was bedeuten spiralförmiger Prozess und ",mindsets" beim TTM? | Ursprünglich war der Veränderungsprozess linear konzipiert; da häufig Rückfälle auftreten, sieht das TTM nun einen spiralförmigen Prozess vor. In den verschiedenen Stadien treten typische „mindsets“ auf; Variablen wie Selbstwirksamkeit und Handlungsergebniserwartung sind jeweils unterschiedlich relevant |
| Weiters werden je 5 kognitiv-affektive und 5 verhaltensorientierte Prozesse der Verhaltensänderung definiert, die sich jeweils für bestimm-te Stadien besonders eignen (TTM) | zB „Bewusstseinserhöhung“: Wahrnehmung von Ursachen, Konsequenzen und möglichen Lösungswegen erhöhen zB „Gegenkonditionierung“: Problemverhalten durch alternatives Verhalten ersetzen Interventionen können abgeleitet werden! |
| Forschungsergebnisse (TTM) | Vor allem das Auftreten verschiedener Prozesse in unterschiedlichen Stadien wurde untersucht; die Stadieneinteilung passt zB besser bei der Raucherentwöhnung als bei körperlicher Aktivität |
| Kritik TTM | unter anderem willkürliche Setzung der Zeitkriterien, Zuordnung von Personen zu den Stadien nicht immer eindeutig möglich |
| Prozessmodell gesundheitlichen Handelns Health Action Process Approach (HAPA) | „Hybridmodell“ – teils kontinuierlich, teils an Stadien orientiert Ausgangspunkt ist die Risikowahrnehmung, die unter Einbeziehung von Handlungsergebniserwartungen und Selbstwirksamkeit die Intention beeinflusst. Über die Phase der Handlungs- und Bewältigungsplanung kommt es zur Handlung. Dabei wird zwischen motivationaler und volitionaler Phase unterschieden. |
| Prozessmodell gesundheitlichen Handelns Forschungsergebnisse | Aus dem Modell abgeleitete, spezifische Vorhersagen konnten in einigen Studien bestätigt werden. |
| Prozessmodell gesundheitlichen Handelns Kritik | Das Modell überwindet zwar die Problematik der Intentions-Verhaltens-Lücke der kontinuierlichen Modelle. Für manche Bereiche sind aber Modelle mit mehr Phasen der Veränderung besser geeignet. |
| Definition: Rückfall | Rückfall = Rückkehr zum Risikoverhalten a) Vorübergehend oder b) Dauerhaft |
| Rückfallforschung | stammt ursprünglich von Suchtforschung ab (vor allem über Alkoholabhängigkeit), in der Gesundheitspsychologie wird die Thematik aber in Bezug auf alle Risikoverhaltensweisen untersucht. Zentrale Frage: Wie gehen Menschen mit Versuchungen und Ausrutschern um? |
| Sucht & Rückfall | Vorstellungen über Rückfälle hängen von Vorstellungen über Sucht ab: 1. Modell der Sucht als moralisches Defizit 2. Modell der Sucht als Krankheit 3. Sozial-kognitive Perspektive: Selbstkontrollmodell der Sucht |
| Modell der Sucht als moralisches Defizit | • Sucht entsteht durch Willens- und Charakterschwäche • Rückfall durch diese Schwäche bedingt • Rückfallprophylaxe durch moralische Stärkung (??) |
| 2. Modell der Sucht als Krankheit | • Sucht ist auf genetische Faktoren zurückzuführen, Abhängigkeit ist körperlich bedingt • Rückfall liegt nicht in der Kontrolle der Betroffenen • Rückfallprophylaxe nur durch völlige Abstinenz möglich • Wird zB von den „Anonymen Alkoholikern“ vertreten: Heilung ist unmöglich, man ist lebenslang Alkoholiker; Rückfall: ein Schluck Alkohol = Krankheit ist wieder voll ausgebrochen |
| Kritik am Modell der Sucht als Krankheit: | • Es gibt nur „abstinent“ oder „rückfällig“. • Rückfall wird als Ausdruck des Scheiterns, des Versagens von Patient/in, Therapeut/in und Behandlung erlebt • Wenn Rückfall als unkontrollierbar gesehen wird, steigt die Wahrscheinlichkeit des Weitertrinkens |
| Abstinenz-Verletzungs-Effekt | Nach dem ersten Schluck entstehen Schuldgefühle; die Gründe für den Rückfall werden ungünstig attribuiert („Ich bin zu willensschwach, um trocken zu bleiben“). Beides erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen schwerwiegenden oder dauerhaften Rückfall. |
| 3. Sozial-kognitive Perspektive: Selbstkontrollmodell der Sucht | • Sucht ist erworbenes Gewohnheitsmuster und kann wieder verlernt werden • Suchtverhalten oft in Stressituationen • Angenehme Konsequenzen des Verhaltens folgen unmittelbar, unangenehme erst viel später, erhöhen aber den Stresslevel • Sucht kann somit als fehlangepasste Stressbewältigungsstrategie verstanden werden• Am Erwerb günstiger wie ungünstiger Verhaltensweisen sind verschiedene Faktoren beteiligt, viele davon stehen nicht unter der Kontrolle des Individuums • Die Beendigung des ungünstigen Verhaltens liegt aber in der Verantwortung des Betroffenen (der sich dazu auch Hilfe suchen kann) • Bei der Beendigung gibt es drei Phasen: Motivation (bis zur Bildung einer Intention), Handlung (Ändern des Verhaltens) und Aufrechterhaltung• Beim Prozess des Verlernens kann es zu Ausrutschern kommen, dh Fehlern, die normaler Teil des Veränderungsprozesses sind • Aus solchen Fehlern kann gelernt werden • Als „Rückfall“ gilt erst eine dauerhafte Rückkehr zum süchtigen Verhalten • „Kontrolliertes Trinken“ ist ebenso ein Erfolg wie Abstinenz |
| Marlatt (1996; Marlatt & Gordon, 1985) entwickelte auf dieser Basis das sozial-kognitive Modell des Rückfallprozesses | • Sucht ist gelerntes Verhalten und kann durch einen Prozess wieder verlernt werden • Zentrale Rolle spielen Hochrisikosituationen • Bedingungen, die Hochrisikosituationen begünstigen, können individuell identifiziert werden • Es gibt Strategien, welche die Wahrscheinlichkeit von Rückfällen reduzieren • Kann auf alle Suchtformen angewandt werden |
| 4 Kategorien von typischen Hochrisikosituationen: | 1. Negative emotionale Zustände, zB Angst, Ärger, Frustration, Langeweile 2. Negative soziale Situationen, zB Konflikte, Einsamkeit 3. Sozialer Druck, zB durch die süchtige Peer group 4. Verschiedenes: Positive emotionale Zustände, alkoholbezogene Reize, unspezifisches Verlangen, Testen der eigenen Willensstärke Auf 1.-3. folgen ca. ¾ aller Rückfälle; besonders häufiger Anlass: negative emotionale Zustände |
| Hochrisikosituationen haben verdeckte Vorbedingungen wie etwa: | • Scheinbar irrelevante Entscheidungen (zB Alkohol kaufen, weil Freunde kommen könnten) • Lebensstilfaktoren (zB unausgewogener Anteil von Wollen und Sollen im Leben) |
| Kommt es zu einem Ausrutscher, ist die Attribuierung (Ursachenzuschreibung) entscheidend: | • internal - external • stabil - variabel • global - spezifisch Besonders ungünstig: internal, stabil und global Besonders günstig: external, variabel und spezifisch Durch die Attribuierung wird das Risiko beeinflusst, ob auf den Ausrutscher ein Rückfall folgt. |
| Interventionsstrategien und Programme zur Rückfallprävention: | 1. Balance des Lebensstils 2. Maßnahmen zur Identifizierung von Rückfallrisiken 3. Maßnahmen zur Verbesserung der Bewältigungskompetenz 4. Maßnahmen zur Veränderung rückfallbezogener Kognitionen (zB Attributionen) |
| Gesundheitserziehung | Seit 19. Jhdt. bis heute, Informationsvermittlung in der Schule, zB über Hygiene; Themen der öffentlichen Gesundheit |
| Gesundheitsinformation/ Gesundheitsaufklärung | Seit Beginn 20. Jhdt. bis heute, Information über die schädlichen Folgen von Risikoverhalten (Prävention) |
| Gesundheitsberatung | – individuell zugeschnittene Info wird in Beratungsgespräch vermittelt (Prävention) |
| Gesundheitsförderung | Derzeit favorisiertes Modell, Förderung der Gesundheit unter aktiver Einbeziehung der jeweiligen Zielgruppe und Berücksichtigung ihrer Lebensumstände und -bedingungen; zielt auf die Stärkung der gesundheitlichen Entfaltungsmöglichkeiten; einbezogen werden ökonomische, kulturelle, soziale, bildungsbezogene und hygienische Aspekte |
| Gesundheitsförderung - Definition (WHO, 1986; „Ottawa-Charta“): | Gesundheitsförderung ist ein Prozess, der Menschen dazu in die Lage versetzen soll, mehr Einfluss auf ihren Gesundheitszustand zu entwickeln und ihre Gesundheit aktiv zu verbessern. Ziel ist die Erreichung eines Zustandes vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens, der dadurch erreicht werden soll, dass Individuen und Gruppen unterstützt werden, eigene Wünsche wahrzunehmen und zu realisieren, Bedürfnisse zu befriedigen, sowie die Umgebung zu verändern oder sich an diese anzupassen. Gesundheit ist ein positives Konzept, das sowohl soziale und individuelle Ressourcen als auch körperliche Fähigkeiten betont. Aus diesem Grund ist Gesundheitsförderung nicht nur im Kompetenzbereich des Gesundheitssektors anzusiedeln, sondern Gesundheitsförderung geht weiter als ein gesunder Lebensstil zum Wohlbefinden. |
| Wo finden Gesundheitsförderung und andere gesundheitsbezogene Interventionen heute statt? | • HausärztInnen • Arbeitsplatz • Schulen und Kindergärten • Gesundheitssystem • Öffentlicher Raum: Gemeindebasierte Interventionen, Kampagnen • Forschungsprojekte |
| Forschungsschwerpunkt an der Universität Wien - Gesundheitsförderung | Gesundheitsförderung für Menschen mit intellektueller Behinderung (G. Weber) • Menschen mit IB weisen spezielle Gesundheitsrisiken auf (Ernährung, Bewegung…) • Modelle des Gesundheitsverhaltens sind oft nicht anwendbar, da zB zu komplex • Eigenes Modell und eigene Interventionsformen müssen entwickelt werden |
| Wie kann man aus Theorien zum Gesundheitsverhalten konkrete gesundheitspsychologische Interventionen ableiten? | Beispiel für Intervention ohne Theoriebezug Bsp. „Grim Reaper“: Australischer TV-Spot im Rahmen einer HIV-Präventionskampagne (1987) http://www.youtube.com/watch?v=U219eUIZ7Qo Forschungsergebnis: Erlebte Bedrohung hat keinen hohen Vorhersagewert für Gesundheitsverhalten |
| Kritik Interventionen ohne Theoriebezug | Probleme bei der Beantwortung folgender Fragen: • Wirken sie? • Warum (nicht)? • Wenn ja, wie genau? • Wenn ja, warum auf wen wie stark? • Etc |
| Theoriebasierte Intervention | Beispiel1 : Förderung der Selbstuntersuchung der Brust zur Früherkennung von Brustkrebs Theoretische Basis: Prozessmodell gesundheitlichen Handelns (Schwarzer, 1992) Ziel: Erhöhung der Selbstwirksamkeit durch Handlungserfolg Methoden: Film vs Ausprobieren am Silikonmodell Ergebnis: Häufigkeit der Selbstuntersuchung wurde durch Ausprobieren erhöht |
| Gesundheitspsychologische Interventionen in der Praxis am Beispiel Krankenhaus | (Fiktives) Beispiel: „Familie Mayer“ Vater: Peter Mayer, 41 Jahre, Elektriker Mutter: Sonja Mayer, 42 Jahre, Buchhalterin Tochter: Hanna, 13 Jahre Sohn: Moritz, 9 Jahre Frau Mayer tastet einen Knoten in ihrer Brust. Durch verschiedene Untersuchungen wird Brustkrebs festgestellt. Es wird ihr empfohlen, sich mit einer Operation, einer Chemotherapie und einer Strahlentherapie behandeln zu lassen; dann hat sie sehr gute Chancen, dauerhaft gesund zu bleiben. |
| Belastung Behandlung mit Brustkrebs | Krebserkrankungen sind mit starken psychischen Belastungen verbunden. Ursachen: ➢ Existenzielle Bedrohung ➢ Angst vor Leid und Isolation ➢ Erkrankung und Behandlungen führen (zumindest vorübergehend) zu Verlusten, körperlichen Beschwerden und Schmerzen, Funktionseinschränkungen und/oder Verminderung der Lebensqualität Krebs betrifft immer die ganze Familie! Krisen, Angst, Trauer bei PatientInnen und Angehörigen sind häufig und normal. Behandlungsbedürftige psychische Störungen treten bei 30-50% der PatientInnen irgendwann im Krankheitsverlauf auf. |
| Protektive Faktoren (Bsp. Fam Mayer) | Bei Familie Mayer wirken mehrere protektive Faktoren: • Gesicherte finanzielle Situation • Abgesehen von der Erkrankung keine weiteren Belastungsfaktoren • Gutes soziales Netz, viel Unterstützung auf verschiedenen Ebenen • Guter Zusammenhalt innerhalb der Familie |
| Was kann die Gesundheitspsychologie Familie Mayer anbieten? | Mutter Sonja: vor und während der onkologischen Behandlung. 1. PatientInnenschulung (Primärprävention) 2. Entspannung (Gesundheitsförderung, Primärprävention) Mutter Sonja: nach Abschluss der onkologischen Behandung. 3. Rehabilitation Vater Peter: Abbau von Risikoverhalten (Primärprävention) 4. Raucherentwöhnung |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.