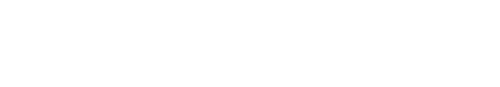6595394
Investitionen
Description
No tags specified
Flashcards by Sabrina Heckler, updated more than 1 year ago
More
Less
|
|
Created by Sabrina Heckler
over 8 years ago
|
|
Resource summary
| Question | Answer |
| Controlling | Beherrschung, Lenkung und Steuerung eines Vorgangs. |
| Sachinvestition | Erwerb von Grundstücken, Maschinen |
| Finanzinvestitionen | Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen |
| Immaterielle Investitionen | Erwerb von Patenten, Konzessionen |
| Unternehmenskauf | Man kauft alles, was zu einem Unternehmen dazugehört (Sachinvestitionen, FInanzinvestitionen und immaterielle Investitionen) |
| Investition | Kapitalverwendung, Umwandlung von Kapital in Vermögen Liegt dann vor, wenn der augelöste Zahlungsstrom mit einer Auszahlung beginnt |
| Für Investitionsrechnung relevante Daten | Anschaffungskosten, Nutzungsdauer, Eventueller Restwert, Rückbaukosten/Abbruchkosten, Laufende Kosten bzw. Erlöse, Zinssatz, Jeweilige Zahlungszeitpunkte, Tilgung eventueller Kredite |
| Anschaffungskosten | Bruttokaufpreis inkl. Umsatzsteuer - Umsatzsteuer = Nettokaufpreis - Rabatt - Skonto = effektiv gezahlter Preis (wird häufig auch als Nettokaufpreis bezeichnet) |
| Anschaffungsnebenkosten | Effektiv gezahlter Preis + Transport-/Frachtkosten + Montagekosten + Notarkosten + ... + nachträglicher Einbau von Sicherheitsausstattung in Luxus PKW = für Investitionsrechnung anzusetzender Wert |
| Nutzungsdauer | Bestimmt mit welchem Prozentsatz ein Wirtschaftsgut jedes Jahr abgeschrieben werden kann. Sind jedoch nicht in jedem Fall bindend, falls er eine andere Nutzungsdauer nachweisen kann. |
| eventueller Restwert | Restwert wird vorab in der Regel nur geschätzt zu berücksichtigen ist ein realistischer Restwert zum jeweiligen Zeitpunkt der Entscheidung bzw. Berechnung |
| Rückbaukosten/Abbruchkosten | z. B. für Fundamente von Winkraftanlage, Druckmaschinen, Renautierung von Braunkohletagebau |
| laufende Kosten/Erlöse | basierend auf der Kostenrechnung |
| Zinssatz | Muss selbst abgeschätzt werden oder durch unternehmensinterne Vorgaben |
| Zahlungszeitpunkte | Manche Investitionsverfahren vetrrachten nicht Kosten/Erlöse sondern konkrete Einzahlungen/Auszahlungen und dort ist der Zahlungszeitpunkt wichtig |
| Tilgung eventueller Kredite | Relevant für die Ermittlung von Zinskosten |
| Kostenvergleichsrechnung | Ermittelt die ksotengünstigste Investalternative durch Vergleich der mit der Investition anfallenden Kosten |
| Gewinnvergleichsrechnung | Erweitert die Kostenvergleichsrechnung um einer Erlösbetrachtung, wenn Erlöste bei verschiedenen Investitionen gleich sind => gleiches Entscheidungsergebnis wie bei Kostenvergleichsrechnung |
| Rentabilitätsvergleichsrechnung | Setzt Jahresgewinn einer Investition in Relation zum durchschnittlichen gebundenen Kapital |
| Amortisationsrechnung | Ermittelt den Zeitraum, in dem die Anschaffungsauszahung durch jährliche Einzahlungsüberschüsse ausgeglichen wird. |
| Statische Investitionsrechnung | Betrachtet nur eine Periode z. B. die Anfangsperiode, die Repräsentativperiode oder die Durchschnittsperiode Die Reduzierung auf eine Periode vernachlässigt dabei Zahlungszeitpunkte |
| Kosten | Kapitalkosten: Kalkulatorische Abschreibungen, Kalkulatorische Zinsen Betriebskosten |
| Kalkulatorische Abschreibungen | b = A - RW / n b = Abschreibungen (€ / Periode) A = Anschaffungskosten RW = Restwert n = Nutzungsdauer (Jahre) |
| Kalkulatorische Zinsen ohne Restwert | Z = A / 2 mal i Z = Zinsen (€ / Periode) A = Anschaffungskosten i = Kalkulationszinssatz (%) |
| Durschnittliches gebundenes Kapital ohne Restwert | A / 2 A = Anschaffungskosten |
| Kalkulatorische Zinsen mit Restwert | Z = A + RW / 2 mal i Z = Zinsen A = Anschaffungskosten RW = Restwert i = Kalkulationszinssatz (%) |
| Durschnittliches gebundenes Kapital mit Restwert | A + RW / 2 A = Anschaffungskosten RW = Restwert |
| Betriebskosten Beispiele | Personalkosten Materialkosten Instandhaltungskosten Raumkosten Energiekosten Werkzeugkosten |
| Kapitaldienst | Abschreibungen + Zinsen |
| Leistungsmenge Kapazität | Leistungsmenge: Ist-Menge Kapazität: Mögliche Menge |
| Kritische Auslastung | Die Leistungsmenge, bei der zwei Investitionsalternativen die gleichen Kosten haben Kosten sind abhängig von der Auslastung y = mx + b b = fixe Kosten m = variable Kosten |
| Kostenvergleichsrechnung Ersatzentscheidung | Ersatz ist sinnvoll, wenn Kosten der Neuanschaffung kleiner sind als die Kosten der Weiternutzung. Sollten die Kosten gleich sein ist es sinnvoll bei der alten Anlage zu bleiben. |
| Verringerung des Liquidationserlöses (des Restwertes) | I = LAV - LEV / V I = Durchschnittl. Verringerung der Liquidationserlöses (€) LAV = Liquidationserlös (Resterlöswert) am Anfang der Vergleichsperiode LEV = Liquidationserlös zum Ende der Vergleichsperiode V = Umfang der Vergleichsperiode (Jahre) |
| Kalkulatiorische Zinsen | Z = LAV + LEV / 2 mal i Z = Zinsen pro Periode LAV = Liquidationserlös (Resterlöswert) am Anfang der Vergleichsperiode LEV = Liquidationserlös zum Ende der Vergleichsperiode i = Kalkulationszinssatz (%) |
| Vorteile Kostenvergleichsrechnung: Verfahrungsbeurteilung | Einfach zu handhaben Datenerhebung ist relativ einfach |
| Nachteile Kostenvergleichsrechnung: Verfahrungsbeurteilung | Entwicklung im Zeitablauf wird nicht berücksichtigt, Aufteilung in fixe un variable Kosten in der Praxis teilweise schwierig, Erlöse nicht berücksichtigt, keine absolute Beruteilung der Investition, Kapitaleinsatz nur in Form von "durchschnittlichen Zinsen", nicht jedoch der Kapitaleinsatz an sich, Zinsen berückichtigen nicht den zeitlichen Verlauf von Ein- und Auszahlungen, Qualitative Aspekte nicht berücksichtigt |
| Gewinnvergleichsrechnung | Gewinn = Erlöse - Kosten Investition sinnvoll wenn: Gewinn > 0 Gewinn > Gewinn einer Alternativinvestition |
| Gewinnvergleichsrechnung "Ersatzentscheidung" | Achtung: •„Gewinn pro Stück“ nur (sicher) aussagefähig, wenn „gleiche Mengen“ •Bei ungleichen Mengen => Gefahr von Fehlentscheidungen |
| Gewinnvergleichsrechnung Verfahrensbeurteilung | Die Gewinnvergleichsrechnung ist eine Erweiterung der Kostenvergleichs-rechnung durch Einbeziehung der Erlöse. => Beurteilung damit häufig ähnlich |
| Gewinnvergleichsrechnung "Verfahrensbeurteilung" Vorteile | •einfach zu handhaben •Datenerhebung relativ einfach •Erlöse werden berücksichtigt •Die absolute Vorteilhaftigkeit einer Investition wird ermittelt (Gewinn >0) |
| Gewinnvergleichsrechnung "Verfahrensbeurteilung" Nachteile | •Entwicklung im Zeitablauf wird nicht berücksichtigt •Aufteilung in fixe und variable Kosten in der Praxis teilweise schwierig •Kapitaleinsatz nur in Form von „durchschnittlichen Zinsen“ berücksichtigt; nicht jedoch der Kapitaleinsatz „an sich“ (Kapital ist typischerweise ein Engpass in Unternehmen) •Zinsen berücksichtigen nicht den zeitlichen Verlauf von Einzahlungen/Auszahlungen •Qualitative Aspekte nicht mit berücksichtigt |
| Rentabilitätsvergleichsrechnung Formeln | |
| Rentabilitätsvergleichsrechnung | •„Durchschnittlicher Gewinn“ (vor Zinsen!): •zusätzlicher durchschnittlicher Gewinn oder •zusätzliche Kostenersparnis •Dabei kein Ansatz von kalkulatorischen Kosten •Durchschnittlicher Kapitaleinsatz: Ermittlung „wie bisher“ •Investition vorteilhaft wenn: •Einzelnes Investitionsobjekt: R ≥ Rmin •Investitionsvergleich: R1 > R2 d.h R1=vorteilhaft |
| Rentabilitätsvergleichsrechnung Varianten | Einzelinvestition Auswahlproblem Ersatzproblem |
| Kalkulatorische Zinsen | |
| Rentabilitätsvergleich Einschränkungen | |
| Rentabilitätsvergleich: Ersatzentscheidung Formeln | |
| Rentabilitätsvergleichsrechnung Vorteile | •Noch relativ einfach zu handhaben •Datenerhebung relativ einfach •Erlöse werden berücksichtigt •Die absolute Vorteilhaftigkeit einer Investition wird ermittelt (Rentabilität > Vergleichszinssatz) |
| Rentabilitätsvergleichsrechnung Nachteile | •Entwicklung im Zeitablauf wird nicht berücksichtigt •Aufteilung in fixe und variable Kosten in der Praxis teilweise schwierig •Zinsen berücksichtigen nicht den zeitlichen Verlauf von Einzahlungen/Auszahlungen •Qualitative Aspekte nicht mit berücksichtigt |
| Amortisationsvergleichsrechnung Formeln | |
| Amortisationsvergleichsrechnung Einzelinvestition | Investition wird von Unternehmen dann durchgeführt, wenn •Amortisationszeit < Nutzungsdauer (d.h. wirtschaftlich) UND •Amortisationszeit < vom Unternehmen vorgegebene Max.Zeit (Risikobegrenzung) |
| Amortisationsvergleichsrechnung: Auswahlproblem Entscheidung | Das kürzere, da man sein "Geld" schneller wieder rausbekommt |
| Amortisationsvergleichsrechnung: Ersatzproblem | |
| Amortisationsvergleichsrechnung Vorteile | •einfach zu handhaben •Datenerhebung relativ einfach •Erlöse und Kapitalbedarf werden berücksichtigt •Die absolute Vorteilhaftigkeit einer Investition wird ermittelt (Amortisationszeit < Nutzungsdauer) |
| Amortisationsvergleichsrechnung Nachteile | •Entwicklung im Zeitablauf wird nicht berücksichtigt •Rückflüssen nach dem Amortisationszeitpunkt werden nicht berücksichtigt. •Keine Ermittlung des Erfolgsbeitrags (Gewinn oder Rentabilität) über den Gesamtzeitrum der Nutzung der Investition •Qualitative Aspekte nicht mit berücksichtigt |
| Dynamische Investitionsrechnungen | Kapitalwertmethode Interne Zinsfußmethode Annuitätenmethode |
| Barwert | Ein Freund hat einen Sparvertrag, der Endes des Jahres (31.12.) ausläuft. Der Auszahlungsbetrag wird 10.000 € sein. Er benötigt aber heute (1.1. des Jahres) dringend Geld. Sie wollen ihm das Geld „vorstrecken“. Dabei soll gelten: keiner soll dadurch einen Zinsvorteil haben. Welchen Wert haben (zukünftige) Zahlungen einer Periode zu Beginn der Periode. |
| Barwert Berechnung mit Abzinsungsfaktor | |
| Barwert Berechnung mit Barwertfaktor | |
| Endwert | Analog zu Barwert: Wert einer Zahlung(-sreihe) am Ende der Betrachtungsperiode |
| Endwert Berechnung | |
| Kapitalwertmethode | Kapitalwert zu Beginn der Nutzungsdauer ist Maßstab für Vorteilhaftigkeit |
| Kapitalwertmethode Formeln | |
| Kapitalwertmethode Entscheidung | •Kapitalwert > 0: Investition erwirtschaftet über Verzinsung hinaus einen Investitionsgewinn •Bei Vergleich zweier Investitionen: Investition mit höherem Kapitalwert vorteilhafter |
| Kapitalwertmethode Vorteile | •Berücksichtigt die zeitliche Verteilung von Zahlungsflüssen •Differenzierte Abbildung von Zahlungsflüssen |
| Kapitalwertmethode Nachteile | •Relativ viel Aufwand für die Ermittlung der notwendigen Daten •Unsicherheit der Höhe und des Zahlungszeitpunktes •Relativ schwer interpretierbar, da keine „leicht verständliche“ Interpretation des Kapitalwertes „als Zahl“ (d.h. tatsächliche Rentabilität wird nicht gezeigt) |
| Interne Zinsfußmethode | Interner Zinsfuß: der Zinssatz, bei dem der Kapitalwert einer Investition = 0 ist. (Der Abzinsungsfaktor in der Tabelle muss so hoch sein,d ass unten bei Kapitalwert 0 rauskommt) Siehe Übungsaufgabe F. 118 |
| Interne Zinsfußmethode - Eine Investition ist vorteilhaft, wenn... | •wenn der interne Zinsfuß > der vom Unternehmen festgelegten Mindestverzinsung ist •Bei Investitionsvergleich: die Investition mit dem größeren internen Zinsfuß |
| Interne Zinsfuß-Methode Vorteile | •Genauere Aussage über Rentabilität einer Investition •Berücksichtigt die zeitliche Verteilung von Zahlungsflüssen •Differenzierte Abbildung von Zahlungsflüssen |
| Interne Zinsfuß-Methode Nachteile | •Relativ viel Aufwand für die Ermittlung der notwendigen Daten •Unsicherheit der Höhe und des Zahlungszeitpunktes •„Differenzinvestition“ häufig schwierig definierbar, da sehr häufig sehr fiktiv |
| Controlling als Führungsunterstützung | |
| Was kann unter Controlling verstanden werden? | • Eine Art Führungsphilosophie: Führungsunterstützung mit Zahlen, Daten, Fakten • (Ver-)Mittler zwischen Buchhaltung und Führung • Koordinationsmittel komplexer Unternehmensstrukturen • Rationalitätssicherer im Unternehmen (das „wirtschaftliche Gewissen“ des Unternehmens) |
| Controlling: Veränderung der Rahmenbedingungen | •Dynamisierte Umwelt •Mehr Freiheitsgrade bei der Arbeit •Innovationsdruck •Globalisierung •Stetig steigende Anforderung an das Controlling •Steigende Komplexität -> Entscheidungen werden größer, komplexer und riskanter -> Entscheidungen richtig vorbereiten wird (noch) wichtiger |
| Controlling: Veränderung der Organisationsformen | Hierarchische Organisation • nur der/die Chef(s) erhalten Controlling-Unterstützung Gruppenorg. • In Abhängigkeit von Führungsstruktur und know-how erhält/erhalten nur der Gruppenleiter oder auch die Gruppenmitglieder Controlling-Unterstützung Strategische Netzwerke/Kooperationen • Die GESAMTverantwortl. wollen völlige Transparenz • Die Netzwerkmitglieder wollen keine echte Transparenz an andere Netzwerkmitglieder geben Virtuelle Organisation • Durch wechselnde Verantwortlichkeit. und Strukturen kann Controlling nur Standard-Lösungen entwickeln, evtl. verbunden mit individueller Beratung |
| Aufgaben des Controllings | •Daten aufbereiten und analysieren •Analysen kommentieren •Planungs- und Steuerungs- instrumente aufbauen •Planungsprozesse organisieren •aktiv Steuerungsimpulse geben •betriebswirtschaftlich (ganz- heitlich!?) beraten |
| Das (direkte) Handwerkzeug des Controllings | •Zumindest Grundkenntnisse der Buchhaltung /IFRS •Kostenrechnung •Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung •Prozesskostenrechnung •Investitionsrechnung •Finanzierung •EDV (z.B. Excel, SAP/ERP-Systeme, Datenbanken, Data-Warehouse) |
| Führung | Der Zweck der Führung besteht in der Beeinflussung der Einstellungen und des Verhaltens zur Zielerreichung |
| Koordinationsmechanismen Controlling | Persönliche Weisung Selbstabstimmung Programme Pläne Interne Märkte Unternehmensstruktur |
| Controlling Steuerung | Controlling greift steuernd in die Systeme ein, ist aber auch selbst ein Teil des Systems. |
| Aufteilung des Controlling nach Funktions- Bereichen | |
| Zentrales Controlling | Es gibt eine "Abteilung" für Controlling, die für alle anderen Bereiche zuständig ist. |
| Dezentrales Controlling | Jede "Abteilgung" hat ihr eigenes Controlling |
| Vorteile Zentrales Controlling | • Einheitlichkeit der Controlling-Entscheidungen • Überschneidung von Anforderungen zu Controllingthemen werden vermieden • Kosteneinsparung durch Verringerung des Bedarfs an Personal und Sachmitteln • Förderung des Einsatzes von Controlling-Spezialisten • Möglichkeit der strafferen Controllingfunktion |
| Vorteile Dezentrales Controlling | • Überlastung der zentralen Einheit möglich • Bürokratisierung könnte gefördert werden • Fehlentscheidungen könnten durch fehlende Fachkenntnis herbeigerufen werden, da •Fachabteilungen Controlling-Beratung nicht einfordern / akzeptieren •Controlling praxisfremde Analysen / Empfehlungen gibt • Geringe Anpassungsfähigkeit bei veränderten Rahmenbedingungen • Entscheidungsverzögerung |
| Vorteile des Controllings als zentrale Stabstelle | • Eindeutige Kommunikationswege und direkter Entscheidungsweg (der Führung) • Einheitlichkeit der Controlling-Inhalte |
| Nachteile des Controllings als zentrale Stabstelle | • Konflikte zwischen Stab und Linie bei Abstimmungen/Entscheidungen • Linieninstanz könnte Argumente des Stabes bei Entscheidungen übergehen • Entscheidungen in der Linie für Stab fachlich nicht nachvollziehbar • Controlling zu praxisfern |
| Controlling in der Spartenorganisation | Jede Sparte hat seine eigene "Controlling-Abteilung" |
| Ziele | Unternehmensziele sind Maßstäbe, an denen unternehmerisches Handeln gemessen werden kann. |
| Eigenschaften erfolgreicher Zielmerkmale (SMART-Formel für Zielfestlegung) | Spezifisch, Messbar durch Kennzahlen, Aktiv beeinflussbar, Realistisch, Terminiert |
| Förderlich für Ziele | Selbst gesetzte Ziele, exakte (konkrete) Ziele, Verpflichtung zum Ziel |
| Bei Zielfestlegung ist zu beachten... | Zielauswahl, Zielanzahl, Zielausprägung (-höhe), denkbare Basis für die Festlegung der Zielhöhe - Vergangenheitswerte - Einschätzung der Mitarbeiter - unabgestimmte Vorgaben der Leitung - Benchmarks Zielbeziehungen (komplementär, konfliktär, indifferent), Motivationswirkung, Grundeinstellung „erfolgssuchend“ „misserfolgsvermeidend“? |
| Wirkung von Zielen | - engen die Freiheitsgrade der Führungskräfte ein. - geben Grundstock der Koordination - motivieren („schlechte Ziele“ können demotivieren!) - …. praktische Ausgestaltung von „Führung durch Ziele“ damit sehr unterschiedlich! |
| Problemkreis „Komplexität“ (aus Praxissicht) | - Realität ist komplex - Controller-Aufgabe - Controller muss Komplexität durchdringen / verstehen - sollte Komplexität „reduzieren“ - darf nicht „nur Komplexität abbilden“ - These: Manager haben keine Zeit für „Komplexität“ Zur Komplexitätsreduktion im Controlling werden „Modelle“ genutzt: Modelle: vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit Beispiele/Nutzen? |
| Die (indirekte) Macht des Controllers | - Auswahl von Informationen (Inhalt + Umfang z.B. im Rahmen Modellbildung oder im Berichtswesen) - Form der Analysen - Termin der Informationsweitergabe - Berichtsgestaltung / Wahl des Mediums - Auswahl der Adressaten - Kommentierungen - begleitende informelle Ergänzungs- information beeinflusst die Entscheider / die Entscheidung! |
| Operatives Controlling | aktive Gewinnsteuerung die Dinge "richtig" tun |
| Strategisches Controlling | Die "richtigen" Dinge tun |
| Pyramiede Controlling | |
| Unternehmensplanung | Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. Aus Irrtümern – nicht jedoch aus Zufällen – kann man lernen Planungsprozess = Chance für erfolgreichen individuellen und organisatorischen Lernprozess |
| Aufgaben des Controllers im Planungsprozess | Planungsunterstützung Rationalitätssicherung im Planungsprozess („Kontrolle“ der Planung) Planungsmanagement |
| Planungsunterstützung | • Suche und Aufbereitung relevanter Informationen • Generierung von Entscheidungsalternativen • (monetäre) Bewertung von Entscheidungsalternativen |
| Rationalitätssicherung im Planungsprozess („Kontrolle“ der Planung) | • Inhaltliche Beurteilung von Planungsansätzen • Kritisches Hinterfragen des Planung • Plausibilitätsprüfung |
| Planungsmanagement | • Gestaltung des Planungssystems • Methodische / instrumentelle Unterstützung der Planer • Übernahme von Teilaufgaben des Planungsprozesses |
| Blick aus der Praxis: Planer-Typen | • Der Phantast -> Gefahr: tolle Pläne ohne Bodenhaftung • Der Intellektuelle -> Controller´s Liebling: detailorientiert, i.d.R. eher realistisch • Der Antiplaner -> gestaltet Realität, will jedoch keine Pläne • Der Verweigerer -> lehnt Planung und Gestaltungszwang ab Mögliche Controller-Rolle dabei: wirtschaftliches Gewissen, Realist, „Spielverderber“, Sparringspartner, Überzeuger, Motivator, Durchsetzer, eventuell auch: „frustrierter Controller“ / „Feigenblatt“ |
| Planungsrichtungen | • top-down • bottom-up • Gegenstromverfahren |
| Strategisches Management (Horváth) |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.